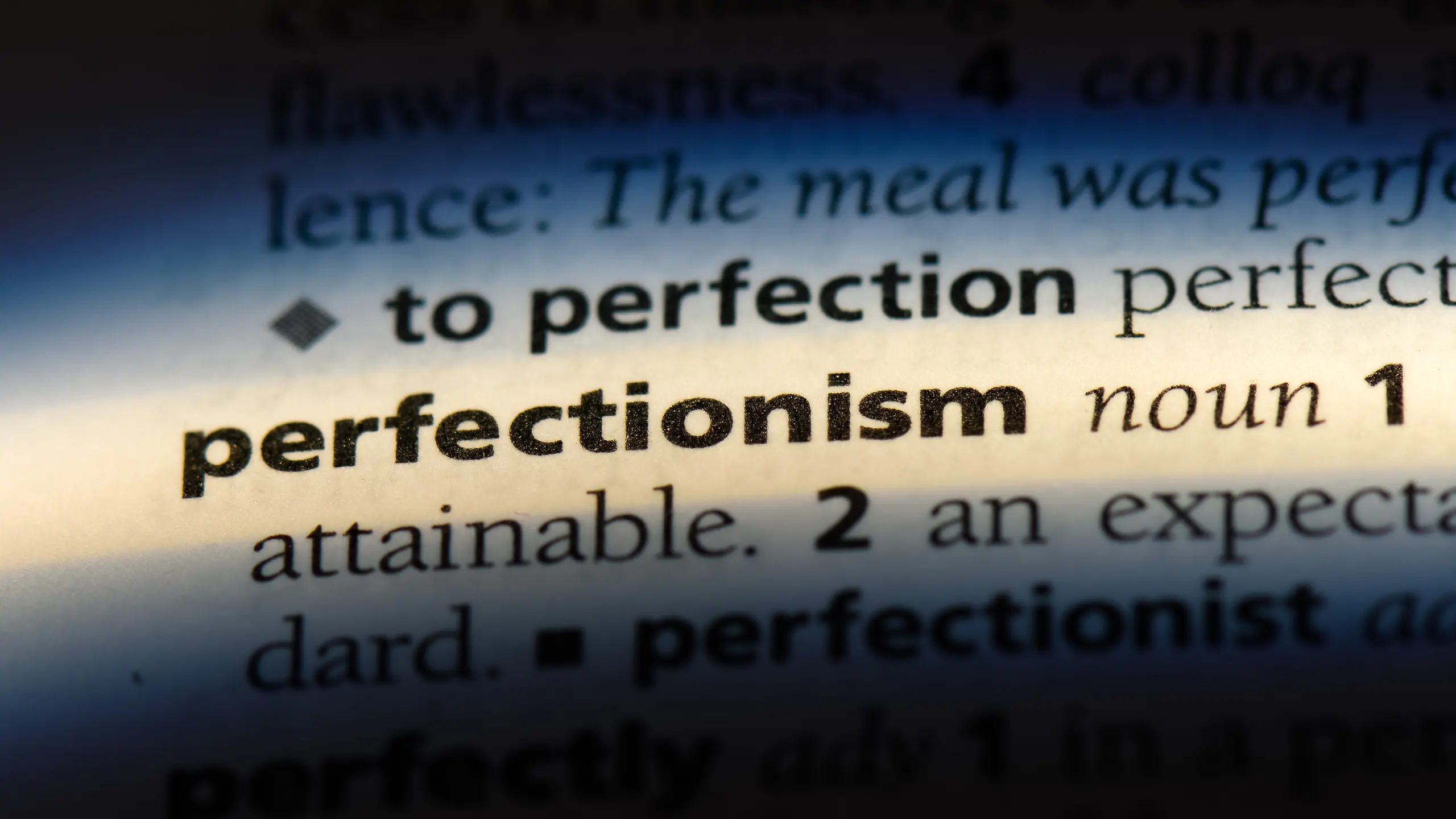
Viele glauben, Perfektion sei der Schlüssel zu Höchstleistung. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wer 100 % geben will, verkrampft – und verliert. Spitzensport und moderne Hirnforschung zeigen: Lockerheit, nicht Maximaldruck, bringt nachhaltigen Erfolg. Perfektionismus kann nicht nur die mentale Gesundheit, sondern auch die Leistungsfähigkeit sabotieren. Ein Prinzip, das heute im Management bedeutsamer ist denn je.
Wenn Perfektion bremst
Stellen Sie sich eine Führungskraft vor, die jede Folie makellos inszenieren will. Kein Komma darf verrutschen, keine Idee unausgereift sein. Nach außen wirkt das souverän, doch hinter den Kulissen wächst der Druck: kurze Nächte, kreisende Gedanken, blockierter Kopf. Psychologen nennen das maladaptiven Perfektionismus – ein Muster, das nicht von Begeisterung, sondern von Angst getrieben ist. Angst vor Fehlern. Angst, nicht zu genügen. Angst, Respekt zu verlieren.
Neurobiologisch beginnt das in der Amygdala, einem Bereich tief im Schläfenbereich des Gehirns. Wird sie aktiviert, schalten Geist und Körper auf Alarm: Stresshormone steigen, das Stirnhirn – zuständig für Planung, Logik und Kreativität – wird blockiert. Statt Lösungen entstehen Schleifen, statt Innovation Stagnation.
Das Gegenmodell liefert der Sport. Der kalifornische Sprinttrainer Bud Winter erkannte schon in den 1950er-Jahren: Wer mit aller Gewalt „100 %“ gab, wurde langsamer. Die Athleten verkrampften, atmeten flacher, verloren Bewegungsökonomie. Dagegen liefen jene schneller, die „nur“ 90 % gaben – entspannt, locker, effizient. Winters Motto: Relax and win.
Sein Ansatz war alles andere als Theorie: Winters Schützlinge gewannen 27 olympische Medaillen und stellten 37 Weltrekorde auf. Lockerheit besiegte Krampf. Während im Sport das Phänomen des „Zuviel-Wollens“ längst bekannt ist, herrscht in Unternehmen oft noch die Überzeugung: Mehr Druck, mehr Motivation, mehr Leistung.
Doch was sagt die Wissenschaft dazu?
Definition Perfektionismus
Perfektionismus ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das sich durch das Streben nach extrem hohen Standards und makelloser Leistung sowie durch eine übermäßige Selbstkritik auszeichnet, was oft mit Versagensangst und psychischem Leid verbunden ist. Es kann funktional (gesund) sein, wenn hohe Ansprüche auf realistische Weise verfolgt werden, aber auch dysfunktional, wenn das Streben nach Perfektion zu Stress, Angst und einem geringen Selbstwert führt, da bereits geringe Abweichungen als Versagen empfunden werden.
Die Psychologie der Perfektion
Die Wissenschaft unterscheidet zwei Spielarten:
Der maladaptive Perfektionismus ist angstgetrieben, geprägt von Furcht vor Fehlern, Kritik und Gesichtsverlust. Die Amygdala übernimmt, das Stirnhirn wird blockiert, das Belohnungssystem verstummt. Selbst Erfolge fühlen sich leer an. Untersuchungen der kanadischen Psychologen Paul Hewitt und Gordon Flett zeigen: Diese Variante ist eng mit Stressstörungen, Depression und Burn-out verknüpft.
Der adaptive Perfektionismus ist dagegen Begeisterungsgetrieben, gespeist aus Freude am Tun. Anspruch entsteht aus Motivation, nicht aus Angst. Neurobiologisch bleibt die Amygdala ruhig, das Stirnhirn aktiv, das Dopamin-System belohnt Fortschritte. Das Resultat: Exzellenz ohne Erschöpfung.
Die israelische Psychologin belegte mit ihrem Team: Angstbasierter Perfektionismus geht direkt mit Prokrastination und Entscheidungsblockaden einher. Wer dagegen innere Motivation findet, erlebt Flow – ein Zustand, den der Pionier der positiven Psychologie Mihály Csíkszentmihályi als Quelle nachhaltiger Höchstleistung beschrieb.
RELAX AND WIN.
Dieser Satz, gleichzeitig Motto und Buchtitel von Bud Winter, wirkt auf den ersten Blick paradox. Wie soll Entspannung zu Höchstleistungen führen? Winters Erfahrung mit Weltklasse-Athleten zeigte genau das: Wer mit verkrampften 100 % ins Rennen ging, wurde langsamer. Muskeln verhärteten sich, Atmung stockte, Bewegungen verloren an Effizienz. Jene Läufer hingegen, die scheinbar „nur“ 90 % gaben, liefen leichter, flüssiger – und am Ende schneller. Vielleicht gefällt Ihnen dieses Zitat auch – und sie möchten es sich auf ein Post-it notieren und an ihrem Arbeitsplatz kleben?
How To Overcome Perfectionism - Dr Gordon Flett
Wie Sportler:innen zu anpassungsfähigen Perfektionist:innen werden können. Lewis und Gordon beleuchten Perfektionismus im Sport und gehen Fragen nach wie: Wie wird Perfektionismus erfasst und begrifflich gefasst? Wie entsteht er? Welche Rolle spielt Achtsamkeit dabei, Perfektionismus zu überwinden? Und warum konzentrieren sich Spitzenathlet:innen auf Anpassungsfähigkeit statt auf Perfektion?
Wie also lässt sich der Weg vom lähmenden zum beflügelnden Perfektionismus und zu einer „Relax and win“-Mentalität gehen?
Drei mentale Erfolgsstrategien gegen die Perfektionsfalle
Es gibt tatsächlich drei einfache aber wirksame Strategien:
Relativieren statt Katastrophieren
Beim maladaptiven Perfektionismus neigen Menschen dazu, kleine Unstimmigkeiten aufzublasen. Ein Tippfehler in einer Präsentation fühlt sich an wie ein Karriereaus, ein kritischer Kommentar wie ein Verriss. Doch objektiv betrachtet sind Fehler meist keine Katastrophen, sondern wertvolle Rückmeldungen. Neurobiologisch passiert bei einer Neubewertung („Reframing“): Die Amygdala wird über mehr Stirnhirneinfluß beruhigt.
Praxis-Tipp:
Stellen Sie sich die Frage: „Wird das in einem Jahr noch wichtig sein?“ In fast allen Fällen lautet die Antwort: nein. Allein diese zeitliche Relativierung senkt das Stressniveau und schafft Gelassenheit im Umgang mit Fehlern.
Freude am Tun statt Jagd nach Anerkennung
Wer Perfektionismus aus sozialer Angst betreibt – also aus dem Bedürfnis, anderen zu gefallen – neigt stärker zu Prokrastination und Blockaden. Der Grund: Der ständige Blick auf äußere Bewertung verstärkt Grübelschleifen und raubt Energie.
Anders bei intrinsischer Motivation: Wer Freude an der Tätigkeit selbst kultiviert, aktiviert das Dopamin-System, das Fortschritte belohnt und in den Flow-Zustand führt. Das Ergebnis sind höhere Motivation und nachhaltigere Leistung.
Praxis-Tipp:
Beenden Sie den Arbeitstag mit einer Mini-Routine: Schreiben Sie drei Dinge auf, die Freude am Tun gebracht haben – unabhängig davon, ob jemand applaudiert hat. So trainieren Sie Ihr Belohnungssystem darauf, Wert im Prozess statt nur im Ergebnis zu finden.
Sinn statt Ego
Resilienz – also psychische Widerstandskraft – wird durch Selbsttranszendenz gestärkt. Der Schritt hinaus aus der Ego-Zentrierung hin zu einem größeren Zusammenhang, ist tiefgreifend wirksam, um sich aus der Alltagslast zu befreien. Wer seine Arbeit nicht als Bühne für die eigene Makellosigkeit sieht, sondern als Beitrag zu etwas Bedeutendem, erlebt Belastungen anders – weniger als Bedrohung, mehr als produktive Verantwortung.
Praxis-Tipp:
Definieren Sie ein persönliches „Wozu“. Fragen Sie sich regelmäßig: „Welchen Unterschied mache ich mit dieser Arbeit – für mein Team, mein Unternehmen oder die Gesellschaft?“ Diese Verschiebung des Fokus vom „Wie wirke ich?“ hin zu „Was bewirke ich?“ verwandelt Druck in Antrieb.
Exzellenz entsteht nicht aus dem Drang nach Fehlerlosigkeit, sondern aus Begeisterung, Sinn und Gelassenheit. Oder wie Bud Winter es formulierte: Relax and win. Wer Perfektionismus aus der Ego-Falle befreit, öffnet den Weg zu echter Performance – im Sport wie im Business.
Quellen
Csíkszentmihályi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row.
Harari, G. M., Swider, B. W., Steed, L. B., & Breidenthal, A. P. (2018). Perfectionism, motivation, and procrastination: A multilevel examination of the within- and between-person effects of perfectionism. Personality and Individual Differences, 123, 77–83. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.024
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 456–470. https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.3.456
Täuber, M. (2023). Das Ende der Angst. Wien: Goldegg Verlag.
Winter, B. (1981). Relax and win: Championship performance. Los Altos, CA: World Publications.

Steckbrief
Dr. Marcus Täuber
Qualifikationen
• Psychosozialer Berater mit Gütesiegel Impuls Pro der Wirtschaftskammer Österreich
• Unternehmensberater und zertifizierter Business-Coach
• Ehemaliger Head of Training beim weltgrößten Biotechunternehmen
Dr. Marcus Täuber ist promovierter Neurobiologe, Lehrbeauftragter mehrerer Hochschulen und Leiter der Brain Changer Academy. Als Autor und Keynote-Speaker vermittelt er, wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse helfen, Denken und Handeln wirksam zu gestalten. Mit fundierter Forschung und klaren Praxistools zeigt er Wege, mentale Stärke und nachhaltigen Erfolg zu fördern.
