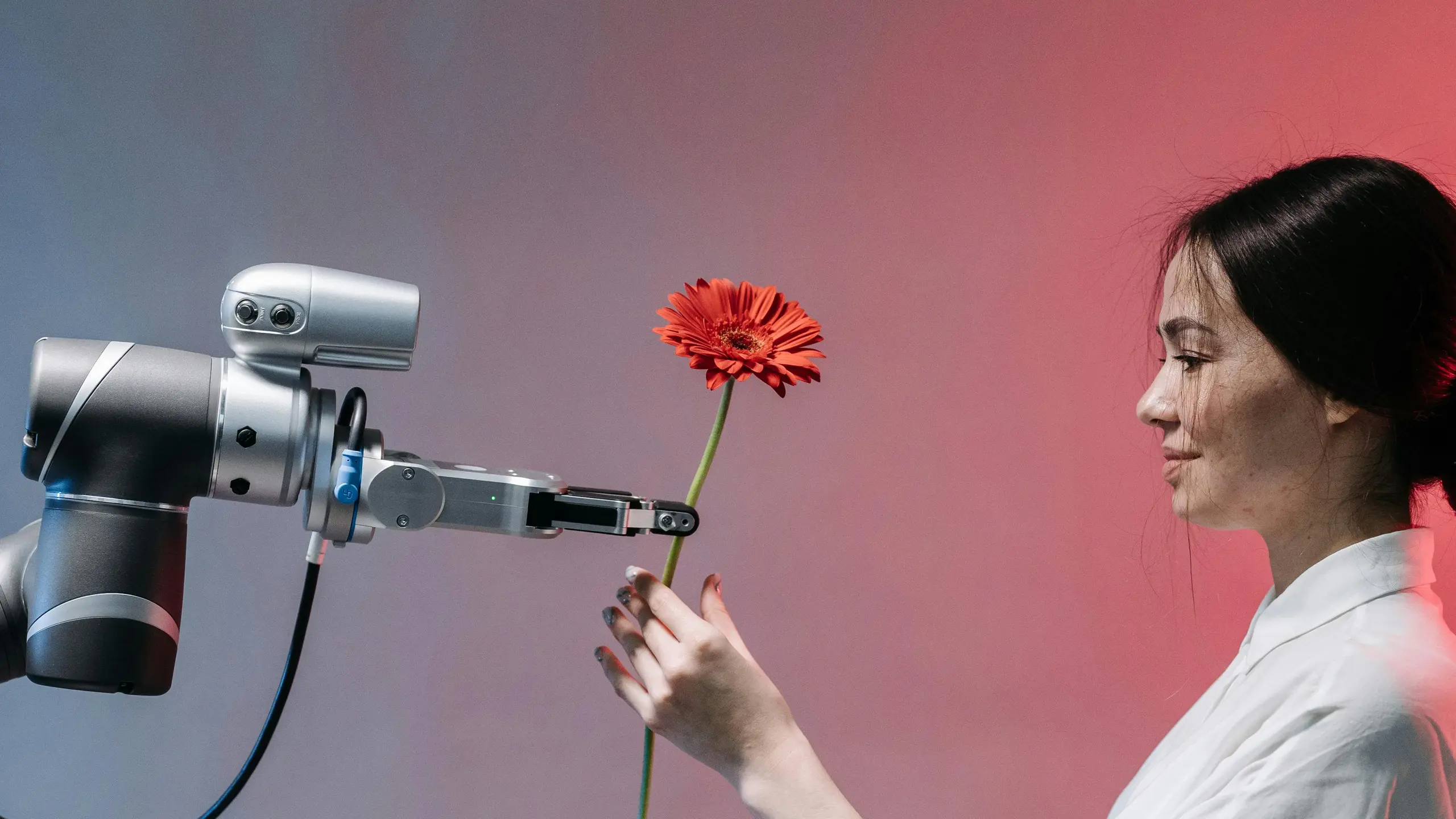
Das gängige Narrativ „Mensch versus Maschine“ verstellt den Blick auf die tatsächlichen Chancen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz.
©PexelsIn Unternehmen wird moderne Technologie oft nicht zielgerichtet eingesetzt. Als Folge scheitern die damit verbundenen Projekte. Forscher rufen nun zu einer „nüchternen Auseinandersetzung mit KI“ auf, um Firmen zum gewünschten Erfolg zu verhelfen.
Die Zahl überrascht: Während Künstliche Intelligenz (KI) allerorten bereits als Commodity gepriesen wird, verzichteten laut Erhebungen der Statistik Austria im Jahr 2024 noch 80 Prozent von Österreichs Unternehmen auf die Nutzung von KI. Die Gründe für die bewusste Enthaltung reichen dabei von ethischen Bedenken über Datenschutzthemen bis zu fehlendem Fachwissen. „Das ist ein Indikator dafür, dass sich der Hype relativiert und manche der Narrative rund um KI bröckeln”, erklärt Stefan Strauß, Wirtschaftsinformatiker vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW).
Besagte Narrative sind häufig widersprüchlich. Versprechen von Produktivitätssteigerung durch KI stehen dem Bedrohungsszenario schwindender Arbeitsplätze gegenüber. Das Ergebnis sei ein hoher Erwartungsdruck, der es Unternehmen erschwere, einen „konstruktiven Umgang mit KI-basierten Technologien zu finden“, so Strauß im heutigen Online-Pressegespräch von „Diskurs. Das Wissenschaftsnetz“.
Metapher „Künstliche Intelligenz“ als Problemherd
Im Hinblick auf KI spricht man selten über die konkrete Technologie. Die gängige Perspektive ist geprägt von Bildern, Metaphern, Erzählungen, zumeist verwurzelt in Science-Fiction und dem Irrglauben, Technologie breche wie eine Naturgewalt über uns herein. „Bereits der Begriff ,Künstliche Intelligenz' ist eine Metapher – und zwar eine sehr wirkmächtige“, erläutert Soziologe Uli Meyer von der Universität Linz: „Hätte man heute zu einem Mediengespräch zum stochastischen Verfahren zur Mustererkennung eingeladen, wäre die Aufmerksamkeit geringer gewesen.“
Das Problem mit den Metaphern: Die mediale Darstellung von KI als Wesen oder Roboter sei, so Meyer, falsch und verstelle den Blick auf tatsächlichen Technologien, die wir bereits tagtäglich nutzen. Das Bild des Gegensatzes von Mensch und Maschine führe zum falschen Glauben, KI-Einsatz bedeute eine Reduktion der menschlichen Arbeitskraft: „Wir haben es stattdessen immer mehr mit soziotechnischen Konstellationen zu tun. Das bedeutet, Technik wirkt nicht alleine, sie wird genutzt.”
Zielgerichtetheit und Anwendungsgebiete
„Mit der Nutzung von KI geht oft ein Fortschrittsversprechen einher“, erläutert Meyer. Organisationen würden Technik demnach häufig einführen, weil sie als modern gelte, und weniger, weil sie ein konkretes Problem löse. Das Ergebnis: „Dann hat man mit KI eine Lösung, die in der Organisation auf der Suche nach einem Problem ist, das sie lösen kann.“ So würden zahlreiche KI-Projekte in Firmen scheitern. „Wir brauchen eine nüchterne Auseinandersetzung mit KI.“
„AI Literacy“ betrachtet Wirtschaftsinformatiker Strauß als Grundvoraussetzung für „eigentlich uns alle“, denn es müsse im Sinne der qualitativen Technologienutzung ein Bewusstsein für fragwürdige, fehlerhafte Ergebnisse geben. Zuverlässigkeit könne man von KI-Systemen nicht erwarten. Dass KI komplexe Aufgaben lösen könne, sei ein besonders gängiges Narrativ. „Komplexe Aufgaben sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht standardisierbar sind.“ Wo sich moderne Technologie hingegen gut einsetzen lasse: in der Automatisierung von repetitiven Routinetätigkeiten. Folglich könne KI zwar keine komplexen Aufgaben lösen, aber durchaus bei der Automatisierung von Routinetätigkeiten unterstützen, die dazu führt, dass eine komplexe Aufgabe einfacher oder effizienter bewältigbar ist.
Selbstverständlich könne man alles mit der KI automatisieren, doch nicht jede Automatisierung sei sinnvoll, betont der Experte und bedient sich in diesem Kontext nun doch einer Metapher: „Sie können natürlich einen Nagel mit einer gefrorenen Banane hineinhämmern. Das wird funktionieren, würde ich meinen. Aber wahrscheinlich ist es besser, Sie nehmen einfach den Hammer.“
Für einen sinnvollen KI-Einsatz in Firmen müsse in erster Linie klar sein, welches Problem gelöst werden soll und ob die entsprechenden Aufgaben überhaupt von KI bewältigbar ist. Dabei mögen Unternehmen nicht außer Acht lassen: KI ist nicht als simples Tool zur Effizienzsteigerung zu verstehen, sie bringt auch mehr Komplexität mit sich – sei es durch Halluzinationen, Bias oder andere Phänomene. Die Systeme gelte es zu betreuen, die Ergebnisse zu überprüfen. Strauß betont: „Es ist sinnvoll, KI als Unterstützungstool für teils viel kleinere Tätigkeiten zu begreifen. Denn KI ist Vieles, aber sie ist nicht die große Revolution.“
