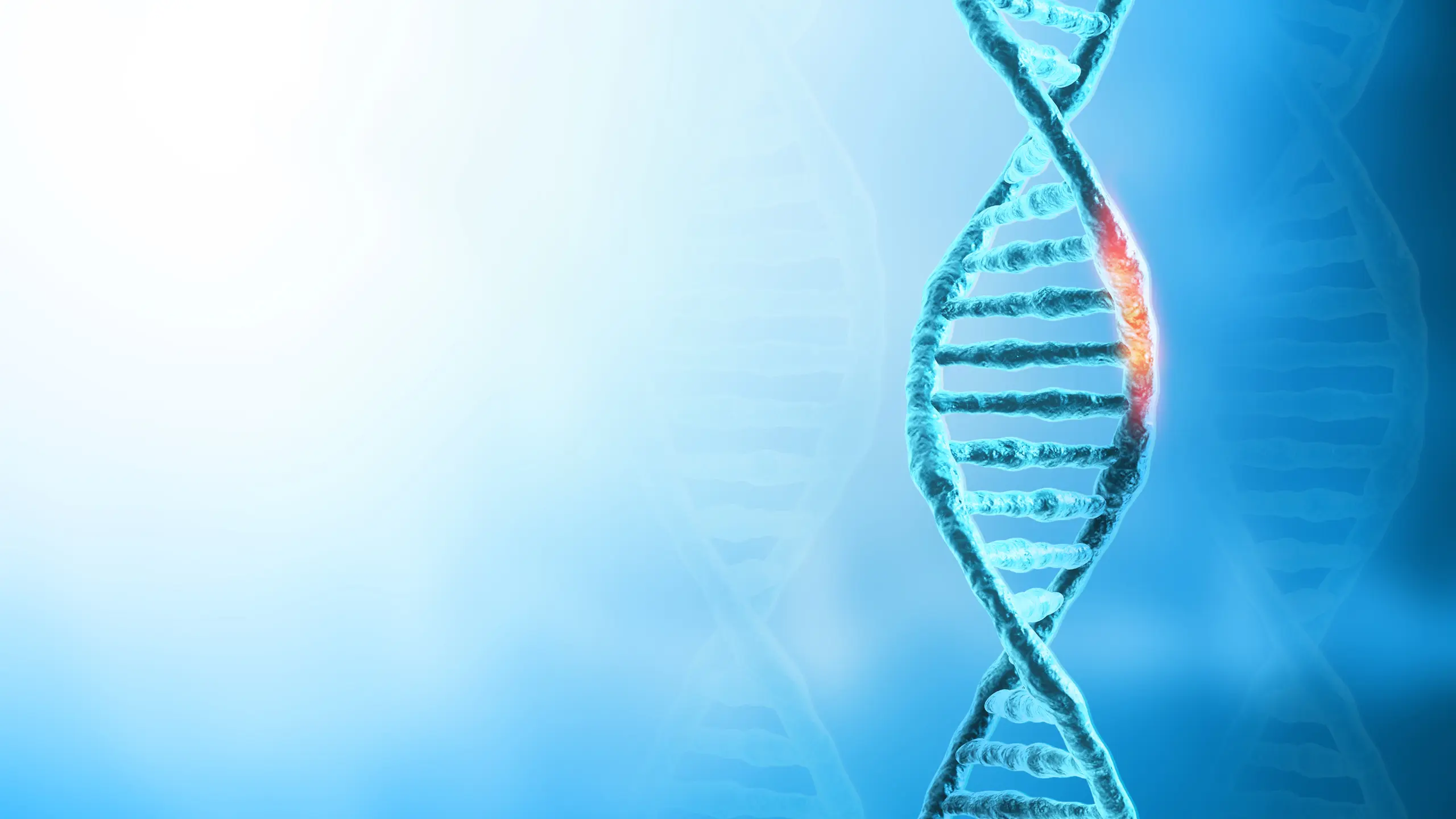
Seltene Erkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten mit sogenannten „Orphan Drugs“ stellen Betroffene, Angehörige, Ärzte und Krankenkassen vor immer größere Probleme. Die Behandlungskosten gehen bisweilen in die Millionen.
Wieder einmal war Karin Modl im Spital gelandet. Eigentlich ist es nur eine harmlose Infektion, doch bei ihr immer eine schwere Erkrankung bis hin zur Lungenentzündung. Eher zufällig erhielt sie die Gelegenheit, sich einen Vortrag anzuhören, der eigentlich für das medizinische Personal gedacht gewesen wäre. „Die Ärzte aus der Abteilung, in der ich lag, hatten keine Zeit, und so haben sie mir gesagt, wenn ich mag, kann ich mir den Vortrag anhören. Es war schon komisch – ich im rosa Bademantel unter den vielen weiß gekleideten Menschen.“ Thema des Vortrags: Primäre Immundefekte – eine Diagnose, die zu diesem Zeitpunkt praktisch nur bei Kindern gestellt wurde.
Für Modl war es wie ein Aha-Erlebnis. „Ich hab mir gedacht: Der redet ja über mich!“ Als sie nach der Präsentation zum Vortragenden, Andreas Böck, Universitätsprofessor mit dem Spezialgebiet pädiatrische Immunologie eilte, handelte dieser schnell entschlossen. „Er hat mir sofort Blut abgenommen.“ Die Diagnose: Primäre Immundefizienz.
Es war die Endstation eines langen Leidensweges. „Ich bin von Arzt zu Arzt gegangen, mir wurde gesagt, ich solle mich zusammenreißen, ein Schnupfen kann ja nicht so schlimm sein. Ich hatte bis zu sieben Lungenentzündungen im Jahr, habe Monate im Spital verbracht. Dennoch wurde mir vorgeworfen, ich wolle nur nicht arbeiten. Einmal wurde ich sogar wegen Leukämie behandelt, nachher bin ich auf der Intensivstation gelandet“, erinnert sich Modl.
„Das ist ein häufiges Problem. Patienten mit seltenen Erkrankungen laufen oft jahrelang mit falschen Diagnosen herum, bis sie endlich richtig diagnostiziert werden“, erklärt Böck, der sich gut an die Patientin erinnert. Nachdem die Symptome eingedämmt waren (eine Heilung ist nicht möglich), unterstützte der Professor seine Patientin dabei, eine Selbsthilfegruppe für Betroffene zu gründen. Inzwischen gilt Modl als eine der Vorreiterinnen solcher Gruppen, in denen Menschen, die an seltenen Krankheiten leiden, Erfahrungen mit Behandlungsmöglichkeiten und den Umgang mit ihrem Leiden austauschen können.
Die Zahl der Betroffenen ist hoch: Rund 8.000 verschiedene „Rare Diseases“ listet die WHO auf. Allein in Österreich liegt die Zahl jener, die unter solchen Krankheiten leiden, zwischen 450.000 und 550.000 Menschen. „Exakte Daten gibt es leider nicht“, so die Epidemologin Elisabeth Kanitz, als Health Expert an der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) mit Projekten zu den Themen seltene Erkrankungen, postakute Infektionssyndrome und Antibiotikaresistenzen betraut. Die GÖG ist die Zentralstelle für die Gesundheitsversorgungsplanung in Österreich.
Langer Leidensweg
Das Problem: Einerseits werden diese Krankheiten oft erst nach einem langen Leidensweg der Patienten diagnostiziert, aber selbst wenn die Diagnose dann vorliegt, ist Hilfe nur in wenigen Fällen möglich: Nur für etwa fünf Prozent der Fälle gibt es zielgerichtete Behandlungen, und die Medikamente sind oft teuer – sehr teuer sogar.
Laut Heilmittelabrechnung des Dachverbands der Sozialversicherungen kostete das teuerste 2024 in Österreich verschriebene Medikament – Amvuttra zur Behandlung der Polyneuropathie bei erblicher Transthyretin-assoziierten Amyloidose, einer Krankheit, bei der es zu Eiweißablagerungen im ganzen Körper kommen kann – exakt 100.612,35 Euro. Die jährlichen Heilmittelkosten für die „teuersten“ seltenen Krankheiten lagen zwischen 650.000 und über 1,5 Millionen Euro – für die Krankenkassen eine Herausforderung, die stetig größer wird.
„Generell ist die Sozialversicherung mit kontinuierlich steigenden Heilmittelkosten konfrontiert“, erläutert Robert Sauermann, Leiter der Abteilung Vertragspartner Medikamente das Problem: „Während das Heilmittelbudget im Jahr 2013 rund 2,6 Milliarden Euro betrug, hat es sich seither deutlich erhöht und betrug im Jahr 2024 bereits 4,6 Milliarden. Im Jahr 2013 entfielen 3,8 Prozent, im Jahr 2024 bereits 7,3 Prozent dieser Gesamtkosten auf Orphan Drugs.“
Dabei sind die immer höheren Kosten vor allem auf steigende Preisniveaus von neueren Arzneispezialitäten zurückzuführen. „Insgesamt zeigt sich, dass ein immer größerer Anteil der Heilmittelkosten auf einen geringen Anteil an Heilmittelpatient:innen entfällt, die auf die teuersten Therapien angewiesen sind. Diese Trends stellen Gesundheitssysteme weltweit vor Herausforderungen“, so Sauermann.
Einerseits besteht der verständliche Wunsch, dass immer mehr Patientinnen und Patienten von Orphan-Drug-Therapien profitieren können. Andererseits stellt der stark wachsende Anteil dieser teuren Therapien an den Gesamtausgaben für die nachhaltige und solidarische Finanzierung des Gesundheitssystems eine große Aufgabe dar.
„Alles, was in Richtung Gentherapie geht, ist eben sehr teuer“, bestätigt Reginald Bittner, Head of Neuromuscular Research Departement an der Meduni Wien. Das Problem bei der Entwicklung der Medikamente: „Für Zulassungsstudien braucht man Patienten, die das Medikament bekommen, und solche, die das Placebo bekommen. Aber die Kohorten sind schon im Vorhinein sehr klein. Außerdem gibt es dann immer mehrere Betroffene, die schon in einer Studie drinnen sind – die fallen dann natürlich auch weg.“ Ein zusätzliches Problem ergibt sich bei den erforderlichen Doppelblindstudien. „Man kann Eltern, deren Kind eine tödliche Krankheit hat, nicht erklären, dass ihr Kind vielleicht nur das Placebo bekommt. Die Eltern drängen dann auf das Verum, also das echte Medikament“, so der Professor.
Eine Herausforderung stellen Orphan Drugs somit auch für die Pharmaindustrie dar. Die geringe Anzahl potenzieller „Konsumenten“ macht es schwer, die enormen Entwicklungskosten zurückzuverdienen. Laut dem Verband der Pharmazeutischen Industrie in Österreich (Pharmig) dauert es durchschnittlich zwölf Jahre, bis ein Medikament die „Marktreife“ erlangt hat. In dem Sektor führend sind nach wie vor die USA als Forschungsstandort Nummer eins für Orphan Drugs. Doch Asien, und hier vor allem China, holt schnell auf.
Um Europa wieder ins Spiel zu bringen, wurde um die Jahrtausendwende ein Anreizsystem auf den Weg gebracht, das die finanziellen Risiken der Entwicklung abfedern soll. Doch diese Initiative scheiterte an institutionellen Hindernissen – die Fragmentierung der EU in einzelne, autonome Mitgliedsstaaten erwies sich als Bremsklotz. Doch hier zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab. Geschaffen wurde das Clinical Trials Information System (CTIS) als Schnittpunkt und zentrale Anlaufstelle zwischen industriellen Sponsoren von Studien, den EU-Mitgliedsstaaten, dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Europäischen Kommission. Über dieses System besteht die Möglichkeit, auf eine von der European Medicines Agency (EMA) eingerichtete Datenbank mit einer Suchfunktion zuzugreifen. Dort können auch Laien Informationen über aktuellen Studien sowie Kontaktdaten abrufen.
„Damit Europa wettbewerbsfähig wird, sind noch weitere Schritte nötig, aber es ist der richtige Ansatz“, so die Pharmig gegenüber trend. Eine weitere Initiative betrifft die EU Pharma Legislation, die Rahmenbedingungen für die europäische Pharmaindustrie definieren soll. Wichtige Themen, die zu regeln sind, betreffen unter anderem die Gebührenreduktion für Anträge, aber auch den wichtigen Themenbereich Patentschutz und Exklusivität. Bestand ursprünglich die politische Forderung nach einer Reduktion des Patentschutzes auf sechs Jahre und der Vereinheitlichung (möglichst niedriger) Einstandspreise, dürfte der Patentschutz nun doch mit zehn Jahren unverändert bleiben. Preisregulierungen und mangelnder Schutz der Exklusivität hätten die für die teuren Entwicklungen so wichtigen Investoren abgeschreckt. „Da hat man auf EU-Ebene erkannt, dass eine Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Verfügbarkeit gefunden werden muss“, so die Pharmig. Die EU-Richtlinie soll noch heuer fertig werden.
Zwei Beispiele lassen erkennen, mit welchen Problemen sich die Pharmaindustrie bei der Markteinführung für Orphan Drugs konfrontiert sieht: Zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA), nach der zystischen Fibrose die zweithäufigste seltene Krankheit, laufen gleich mehrere Studien parallel. Möglicherweise wird also nur ein Bewerber das Rennen machen – alle anderen bleiben auf ihren Kosten sitzen. Und dem in den USA als sensationeller Durchbruch gefeierten Alzheimer-WirkstoffLecanemab wurde von der EU zunächst die Zulassung verweigert. Erst im zweiten Anlauf wurde die Genehmigung erteilt.
Die Letztverantwortung für den Einsatz solcher Medikamente liegt aber bei den Ärzten, und diese führt die Diagnose seltener Erkrankungen oft an ihre Grenzen. „Jeden Donnerstag publiziert das ‚American Journal of Human Genetics‘ neue Erkrankungsgene“, beschreibt Bittner von der MedUni Wien die Informationsflut, mit der sich Ärzte konfrontiert sehen – und zahlreiche Gendefekte betreffen Erkrankungen, die in den meisten Ordinationen noch nie zu sehen waren.
Ein in Medizinerkreisen gern zitierter Spruch lautet „Don’t think of a Zebra“ (im Original: „When you hear hoofbeats, think of horses, not zebras“, Anm.). In ihrer Ausbildung lernen Ärzte, bei der Diagnosestellung zunächst an das Naheliegende zu denken. Konkret: Wenn ein Patient mit Schnupfensymptomen kommt, ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit einfach eine simple Virusinfektion und nicht wie bei Karin Modl eine ausgefallene genetische Immunschwäche. Doch die Erfahrung mit seltenen Krankheiten und Orphan Drugs lehrt: Manchmal ist es eben doch das Zebra.
